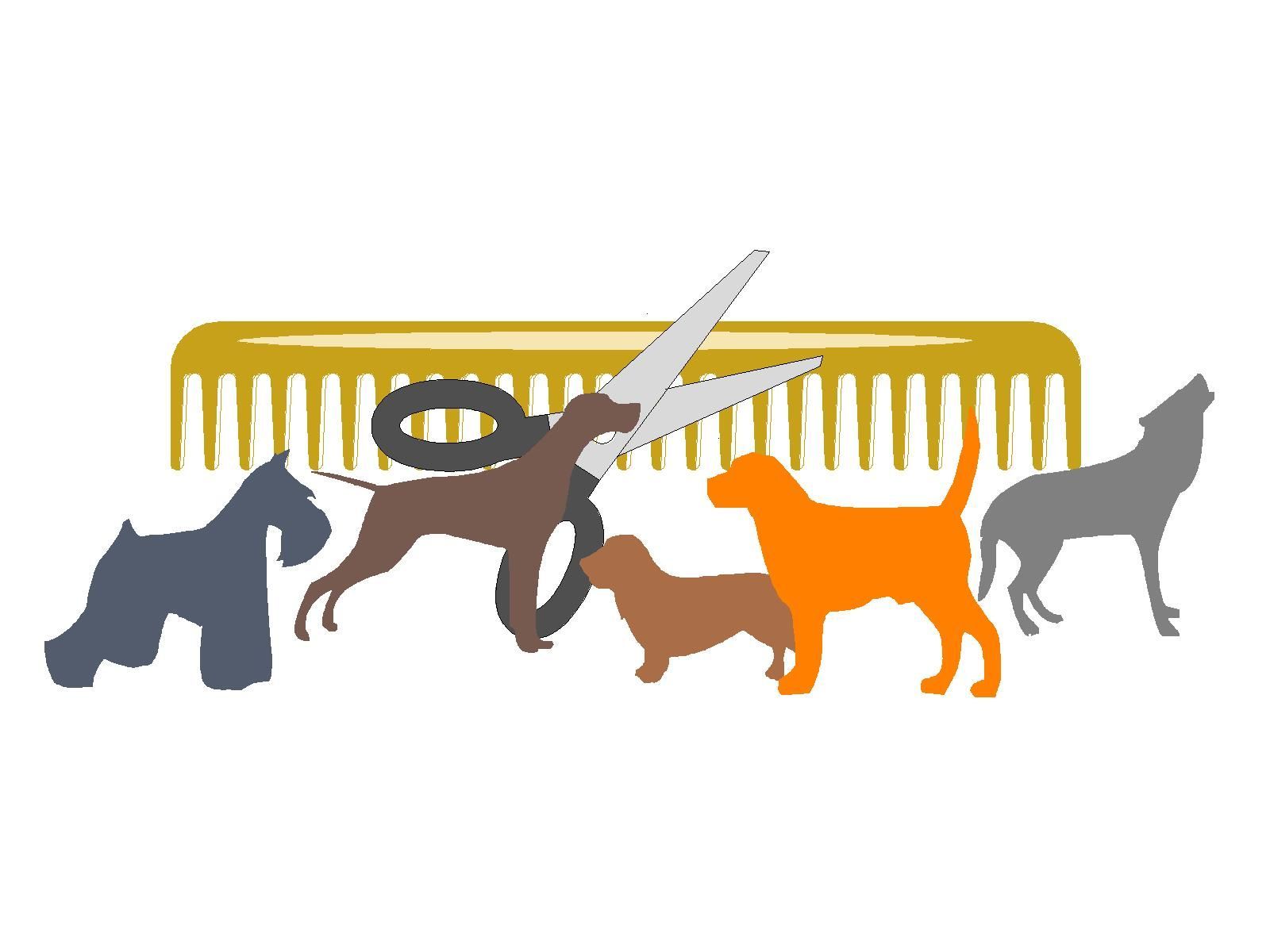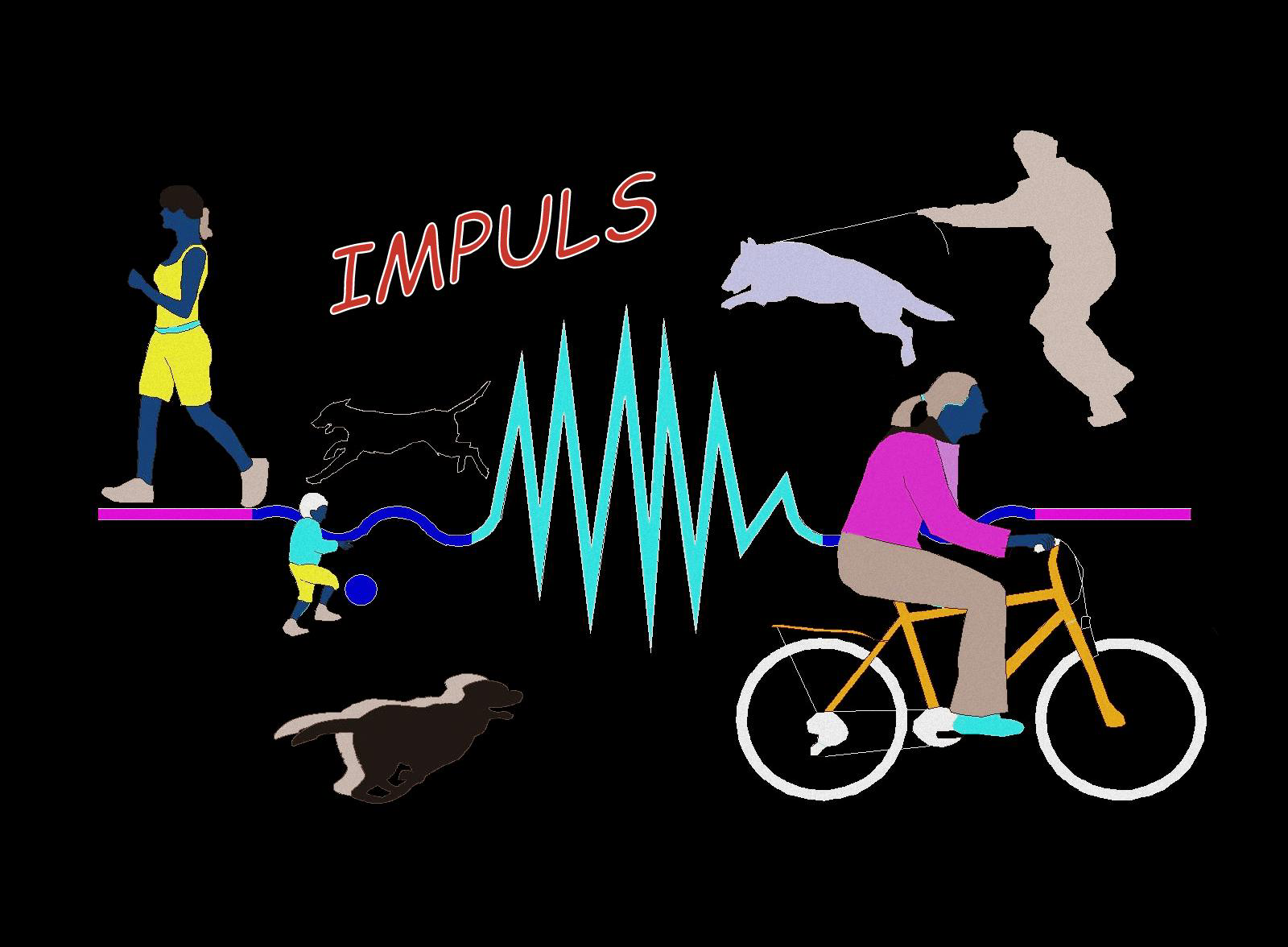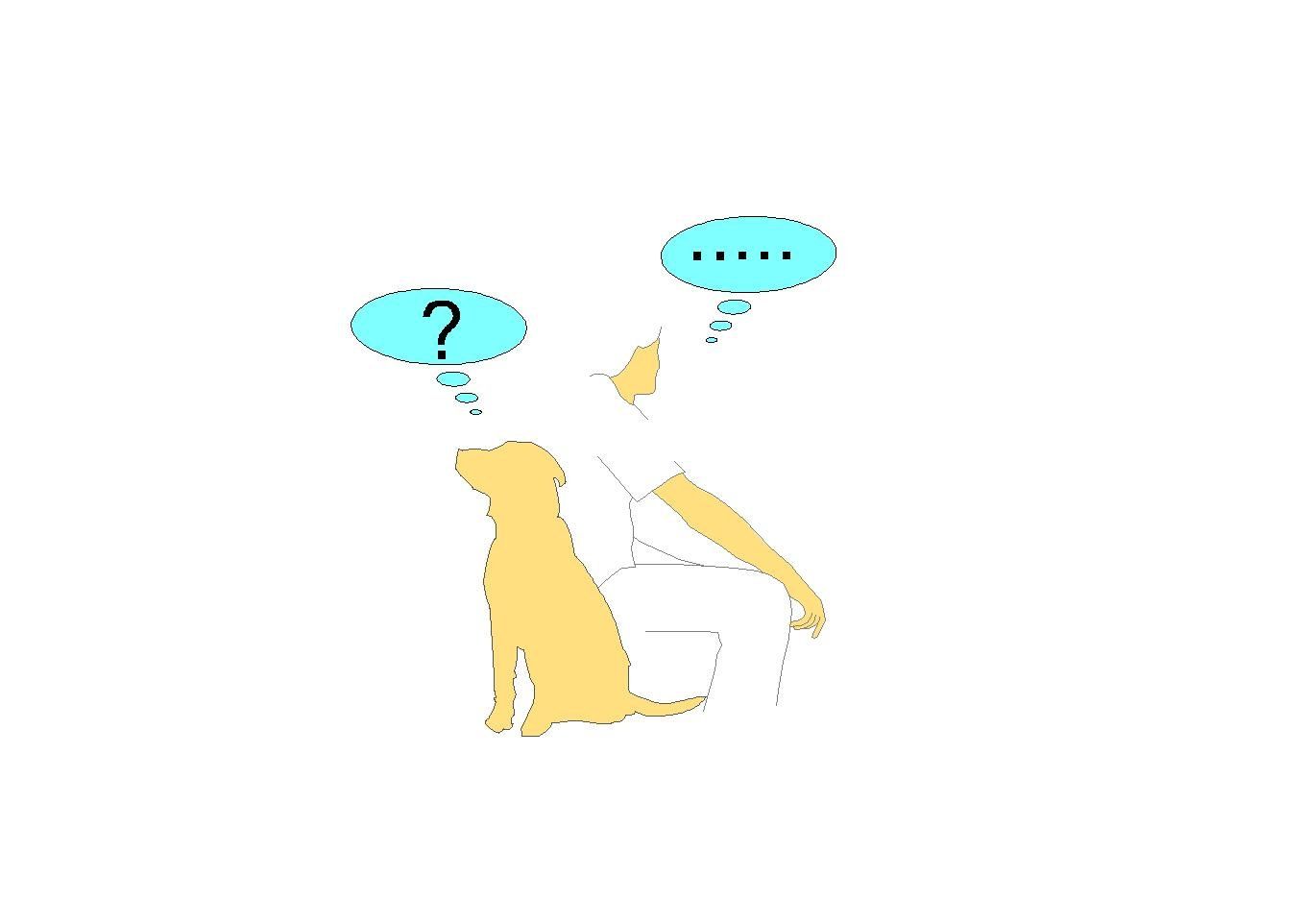Aggressionen haben viele Gesichter
Lebe mit Aggressionen
Lerne mit Emotionen umzugehen
Aggressionen und Aggressivität haben in der Evolution eine lange Tradition und dienen seit der Steinzeit zur Überlebensstrategie jeder Spezies. Zwar bedingen sich neide Emotionen gegenseitig, die Intensität jedes einzelnen Verhaltens hängt dabei aber von vielen Faktoren ab.
Unterschieden wird dabei von einer impulsiven, also von einer affektiven und von einer kontrollierten, also von einer instrumentellen Aggression. Bei der impulsiven besteht ein ziemlich hohes Erregungsniveau. Dagegen herrscht bei einer instrumentellen ein sehr niedriges Erregungsniveau.
Der Antrieb ein aggressives Verhalten zu zeigen ist immer an eine Emotion oder an eine Motivation gekoppelt. Dabei spielen auch momentane psychische oder physischen Konstitutionen, Reize, innere Antriebe oder eine vorhandene Bereitschaft eine große Rolle. Im Prinzip aber dient es letztlich nur dazu, eine momentan vorhandene Erregung aufzulösen.
Leider wird dieses Thema in der Hundewelt und in den Medien mehr emotional als denn rational geführt. Nicht alles was uns ein Hund zeigt ist automatisch mit Aggressivität verknüpft. Es wird oft übersehen, dass jede Handlung für sich genommen nur für das Ende einer langen Kette von kausalen Verknüpfungen steht. Auch wenn wir das oft vergessen, ein Hund kennt unsere soziale Normen nicht.
Emotionen
Der Spruch „Der Fisch beginnt immer vom Kopf an zu stinken“ ist dabei zwar nicht sehr hilfreich, aber dennoch steckt auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter.
Der Fisch beginnt nämlich schon zu stinken, wenn Hundehalter ihre eigenen Emotionen nicht im Griff haben. Emotionen sind gut und wichtig. Aber gerade dann, wenn ein Hund ein nicht erwünschtes Verhalten zeigt, neigt man gerne und schnell zu emotionalen Schnellschüssen. Anstatt sich selbst in Selbstkontrolle zu üben, baut man zusätzliche Emotionen und Aggressionen auf.
Bestrafung als Mittel
Ist Bestrafung ein wirksames Mittel, um das Verhalten Hunden zu ändern? In den USA sorgte eine Studie über Bestrafung und angewandte Gewalt durch den Besitzer für Überraschungen. Nur 6% aller Hunde zeigten über Leinenkorrekturen ein aggressives Verhalten.
Dagegen zeigten 20% bzw. 29% und 30% aggressives Verhalten durch Korrekturen über Wasser spritzen, erzwungene Unterwürfigkeit und Anstarren. Schlagen, Treten, lautes Anschreien und Starkzwang rangierten dabei mit 40% und 43% ganz oben an der Skala.
Durch Bestrafung werden unerwünschte Verhaltensweisen nicht abgebaut. Sie werden dabei auch nicht dauerhaft beseitigt, sondern oft nur kurzfristig unterdrückt. Dabei werden unangemessene Verhaltensweisen vielleicht gestoppt, aber langfristig kein Alternativverhalten aufgebaut.
Auch wenn ein Hund über gezeigte Beschwichtigungssignale einer Bestrafung entgehen kann, heißt es noch lange nicht, dass er dadurch etwas gelernt hat. Eine Einsicht fehlt ihm gänzlich.
Backfire Effect
Der sogenannte „Backfire Effect“ kann dazu führen, dass sich ein Hund durch seinen Besitzer angegriffen fühlt und Gegenbeweisen zum Trotz noch stärker an seinem eigenen Standpunk festhält. Aggressionen und Gegenagressionen spiegeln nur euere beiden Verhalten. Sie beseitigen aber nicht den eigentlichen Auslöser.
Belegt ist, dass sich Hunde auch über aggressives Verhalten des Halters über ihre Außenwelt definieren.
Theoretische Ansätze
Der lerntheoretischer Ansatz von Konrad Lorenz (*7. November 1903; †27. Februar 1989) spricht davon, dass aggressives Verhalten auf einer Vorbildfunktion, also durch Beobachtung stattfindet. Übersetzt heißt das: „Lernen am Vorbild“.
In Anlehnung dieser Hypothese formulierte John S. Dollard (*29. 1900; †8. Oktober 1980), dass eine Aggression auch immer ein Resultat von Frustration sei.
Beide Ansätze, sowohl der des Zoologen als auch der des Psychologen, haben in der Hundeerziehung ihre Berechtigung.
Natürlich ist es schon so, dass Frustration auch einen großen Einfluss auf eine aggressive Handlung hat. Auf der anderen Seite dagegen sind viele Frustrationen einfach zu leicht um Aggressionen auszulösen. Es sei denn, sie bestimmen den eigentlichen Tagesablauf.
Aggressionen haben viele Väter
Die konstruktive Aggression
Die konstruktive Aggression dient bis zu einem gesunden Maß dazu uns im Leben voran zu bringen. Dazu gehört aber auch etwas Mut, um Widerstände von außen nicht immer kommentarlos hinzunehmen. Auch Hunde dürfen das Vorgehen Dritter hinterfragen um sich damit situationsbedingt abzugrenzen.
Die passive Aggressionen
Hinter einer passiven Aggression steckt oft ein ambivalentes Verhalten von verschiedenen Denkmustern und ist durch Widersprüchlichkeit gekennzeichnet. Solche Hunde leisten quasi passiven Widerstand gegenüber allem und jedem. Was nicht in das eigene Denkschema passt wird verjagt. Solche Hunde sind nicht oder nur begrenzt in der Lage Konflikte zu lösen. Oft sind es erlernte negative Erfahrungen die rückschauend nie so richtig zum Erfolg führten. Sie zeigen auf der einen Seite zwar dem Gegenüber die Bereitschaft zu handeln, aber auf der anderen Seite können oder durften sie sich nie so richtig positionieren.
Hundebesitzer neigen leider dazu ihrem Hund wirklich alles zu verbieten, was nur in irgendeiner Weise etwas mit Aggressivität zu tun haben könnte. Gefühle und Emotionen kann man eh nicht abschalten oder unterdrücken. Auf lange Sicht gesehen wäre das für einen Hund die Pest. Es ist weder für seine psychische noch für sein physische Kondition zuträglich, wenn er Konflikte auf Dauer nicht lösen kann.
Der Halter als Auslöser
Viele, nicht die meistens, aber doch viele Verhaltensweisen eines Hundes sind hausgemacht. Das beginnt bei der Vermenschlichung, geht weiter über das negieren oder fehlinterpretieren von Bedürfnissen und endet bei erzieherischen Mängeln. Viele Hunde fallen nur aus dem Raster, weil sie keine keine Lösungen zur Regulierung ihrer momentanen Emotionslage gelernt haben. Wenn jeder kleine Konflikt nur damit endet unterdrückt zu werden, ist das auf Dauer die falsche Konfliktstrategie weil es unheimlich zur Frustration beiträgt.
Je öfter es zu einer Frustration kommt, desto mehr neigt man dazu aggressives Verhalten zu zeigen. Und wenn man dazu auch noch eine zusätzliche Bestrafung erhält, oder eine erwartet, fallen sehr schnell alle Hemmungen. Das kann sich gegen den vermeintlichen Aggressor, gegen Unbeteiligte und sogar gegen den Halter wenden.
Impulskontrolle
Mit seinem Hund an dessen Impulskontrolle zu arbeiten ist zweifelsfrei eine gute Methode. Nur, wann sollte dabei aber wissen wie und wann man dieses Erziehungsmittel anwendet. Manchmal öffnet man dabei versehentlich die Büchse der Pandora. Impulskontrolle sollte eigentlich dazu dienen den „Puls“ eines Hundes herunterzufahren. Bei vielen der propagierten Tipps geschieht aber leider genau das Gegenteil. Oft macht man ihn dabei nur noch wacher und aufmerksamer. Wenn sich gestaute Energien oder Emotionen auf Dauer nicht abfließen lassen, wird das eigentliche angedachte Vorhaben zum Rohrkrepierer. Frust, Wut oder Aggressionen lassen sich nicht immer hinter dem Deckmantel einer Impulskontrolle verstecken.
Je länger man versucht einen Impuls zu kontrollieren, desto schneller und stärker schlägt dieser zurück. Impulskontrolle ist leider nur eine begrenzte Ressource und verbraucht dazu auch noch eine ganze Menge an Energie.
Wie schon erwähnt, Impulskontrolle ist bei der Hundeerziehung ein gutes und geeignetes Werkzeug. Aber manchmal sollte es einfach in der Werkzeugkiste bleiben, damit man gewisse Unarten nicht auch noch verschlimmbessert.
Konflikt oder Eskalation
Oft sieht man dass Hunde in einem inneren Konflikt stecken bleiben weil ihnen ihre Besitzer keine geeignete Strategien zur Deeskalation anbieten können. Wenn ein Hund gelernt hat, dass er für ein Bellen oder für ein Knurren von seinem Besitzer in die Schranken gewiesen wird, ist seine innerartliche Kommunikation gestört.
Beginnt ein Hundebesitzer diese Schraube über Verbieten, über Bestrafung und auch über die Impulskontrolle zu überdrehen, wird das wie schon erwähnt zu einem Rohrkrepierer. Langfristig wird sich ein Hund daher andere Strategien einfallen lassen um seine Privatsphäre zu schützen. Im Worst Case Szenario überspringt der Hund dann gleich mehrere Stufen seiner Deeskalationsangebote. Wenn aus einem Knurren ungehemmte Aggression wird, dann wird’s für alle nicht mehr lustig.
Leben mit Aggressionen
Hundebesitzer müssen sehen wann sich ihr Hund noch in der Deeskalations- und wann er sich schon in der Eskalationsphase befindet. Gerade bei Hundebegegnungen werden Bellen, Drohen, Zähne fletschen, Schnappen etc. durch den eigenen Besitzer oft unterbunden. Es kommt dabei zu einer Ungleichheit der vorhandenen Mittel.
Konflikte beginnen immer mit Spannungen und nicht immer muss das mit einem Krieg enden. Auch ein Hund muss lernen Konflikte anzunehmen, damit umzugehen und nicht gleich mit der großen Keule draufhauen. Dazu gehört aber auch ein Besitzer, der nicht jedes kleine Verhalten gleich unterbindet. Wenn eine Aggressivität dazu dient, seine eigene Versehrtheit zu schützen, sehe ich darin eher eine Deeskalationsstrategie als denn eine offene Kampfbereitschaft.
Selbst der Kleinste „der tut nix“
möchte sich ungern und ungefragt begrapschen oder beschnüffeln lassen.
Konflikte annehmen
Hundebesitzer sollten erkennen, dass Aggressionen auch durch Frustrationen verursacht bzw. angefeuert werden können. An einer Frustration und an einer Impulskontrolle zu arbeiten ist wie schon erwähnt wirklich sinnvoll. Wer aber glaubt, dass man man durch Kontrolle jeden Impuls unterdrücken kann, ist falsch gewickelt.
Nach der Katharsishypothese führen das Ausleben innerer Konflikte und verdrängte Emotionen zu einer Reduktion von Frustrationen. So soll ein Ausleben von Konflikten die Bereitschaft zur Aggressivität senken. Dass sich dadurch aber aggressive Handlungen auf Dauer reduzieren lassen, ist anderseits auch nicht richtig belegbar. Wenn ein bewusstes, also ein zielgerichtetes aggressives Verhalten als Erfolg bewertet wird, wird es eher gefestigt und als Strategie weiter verfeinert.
Auch wenn man das Thema einer Bestrafung in der Hundewelt kontrovers diskutiert, ist und bleibt sie eine wichtige Erziehungsmethode. Nur die Wahl der Mittel dürfen dabei nicht übers Ziel schießen. Sogar eine angekündigte Strafe kann dabei helfen eine Aggression zu hemmen.
„Aber lesen Sie bitte vorher den Beipackzettel und sprechen sie mit ihrem Arzt oder Apotheker ihres Vertrauens darüber!“
Selbsterkennung
Bei der Erziehung ihrer Hunde neigen Besitzer gerne dazu, sich über die Formen der menschlichen Außeinandersetzungen und Konflikte zu definieren. Dazu investieren sie viel Kraft nur um ihre Kontrolle und ihren Status Quo aufrecht zu halten. Weil das aber auch wiederum sehr viel Energie verbraucht, wird ihnen die Steuerung langfristig auf Dauer entgleiten. Was wiederum oft dazu führt die Beherrschung zu verlieren. Zwangsläufig kochen dann Emotionen und Aggressivität bei beiden Parteien auf hoher Flamme.
Eskalationen zwischen Halter und Hund sind keine gute Grundlage um den eigenen Status aufrecht zu erhalten. Gegenseitiges Misstrauen wird dabei ein ständiger Begleiter einer Erziehung sein.
Wenn ich heute in einen Konflikt gehe, muss ich prüfen inwieweit mich meine Strategie weiterbringt ohne dabei mein Gesicht zu verlieren.
Wer ist schon gerne der Looser? Ich nicht so gerne, mein Hund aber auch nicht. Wenn letzterer trotzdem mal verlieren muss, kann man ihm das doch einfach anders verkaufen.
Konflikt
Im Ansatz zu der schon vor kurz erwähnten Eskalationsleiter spricht der Konfliktforscher Friedrich Glasi nur von drei großen Ebenen welche uns bei einer Eskalation zur Verfügung stehen.
- In der ersten Ebene ergibt sich eine Win-Win Situation. In dieser Situation sollte für beide Parteien das beste Ergebnis erzielt werden können.
- In der zweiten Ebene ergibt sich eine Win-Lose Situation.Dabei wird nur für einen der beiden das beste Ergebnis erzielt. Der andere muss erkennen, wann es Zeit wird das Handtuch zu werfen damit er ohne Blessuren davon kommt.
- In der dritten Ebene ergibt sich eine Lose-Lose Situation. Beide Kontrahenten stehen quasi schon am Abgrund weil jeder seinen Status Quo erhalten möchte. Eine Vernichtungsschlacht ist vorprogrammiert und keiner kommt ungeschoren aus dem Konflikt.
Die Chaosstrategie
oder das große Problem verschiedener Nicht-Strategien.
- Rein biologisch gesehen ist die Aggression nichts anderes als ein legitimes Mittel, um die eigene Unversehrtheit und Ressourcen zu schützen. Die Vermutung, dass eine Aggression ein Trieb oder vererbt wird, kann nicht aufrecht gehalten werden. Um einem Trieb nachzugehen, benötigt dieser immer einen Verstärker.
- Wie schon erwähnt werden aggressive Handlungen erlernt. Entweder durch Vorbildfunktion, Frustration oder durch Erfolg. Gerade letzterer führt oft dazu, dass dazu kein Außenreiz mehr benötigt wird, weil selber aktiv nach einem appetitiven Verstärker (Verlangen) gesucht wird um diesen Trieb einzuleiten.
- Nicht immer muss diese Intension mit Aggressivität und auch nicht per se mit einer Beschädigungsabsicht verbunden sein. Oft dient es nur zur Konfliktprävention um damit klare Verhältnisse zu schaffen oder die eigene Macht zu demonstrieren.
- Jeden Konflikt über die eigene Macht (Dominanz) kontrollieren zu wollen ist nicht immer zielorientiert. Dominanz erzeugt zwar den stärksten Druck aber sie trifft nicht immer die richtigsten Entscheidungen. Gleichzeitig wird ein neuer Konflikt erzeugt, was wiederum eine effektive Kommunikation behindert. Zudem wird sich bei allen Beteiligten innerhalb kürzester Zeit eine Orientierungslosigkeit (Chaos) breit machen.
Prävention
Konflikte innerhalb einer Beziehung entstehen immer dann, wenn nicht vereinbarte Ziele zusammentreffen. Die effektivste und schnellste Lösung wäre daher, autoritär seine eigene Ziele durchzusetzen. Wobei dabei der eigentliche Konflikt an sich nicht gelöst, sondern nur überschminkt wird.
Wenn die eigene Handlung ausschließlich dem Willen des Anderen untergeordnet wird, besteht sehr wenig Hoffnung auf Konsens.
Die beste Konfliktprävention ist immer die, die keinen Konflikt entstehen lässt. Das Optimum wäre indes erreicht, wenn man sich gegenseitig Lösungen anbieten könnte. Das ist aber schwer, wenn nicht sogar unmöglich, wenn sich einer davon in einem sozialen Rollenkonflikt befindet.
Zu solchem kommt es dann, wenn sich soziale Rollen innerhalb einer sozialen Gemeinschaft verschieben. Um darin die eigene Position zu festigen benötigt man alles, nur keine Dominanz.
Eine dominante Führung ist innerhalb eines sozialen Gefüges nicht flexibel genug, weil sich jeder einzelne Konflikt situationsbezogen, zeitlich und örtlich weder voraussehen noch planen lässt.
Resümee
Wer nun am Ende alles gelesen hat, wurde vielleicht enttäuscht wenn er eine Erziehungsfibel oder einen Ratgeber erwartet hat. Die vielen Arten einer Aggression sind zu komplex, um jedes einzelne Verhalten zu beschreiben oder zu diagnostizieren. Jeder einzelne Konflikt und jedes aggressives Verhalten muss immer situativ gesehen und für sich einzeln bewertet werden. So etwas wie eine „Betriebsanleitung“ zu schreiben wäre von mir daher sehr vermessen.
Gute Ratschläge zu verteilen und dann abzuhauen ist nicht mein Ding. Aber ein bisschen Vorwissen schadet trotzdem nie.
Danke fürs Lesen
Manfred Gibisch