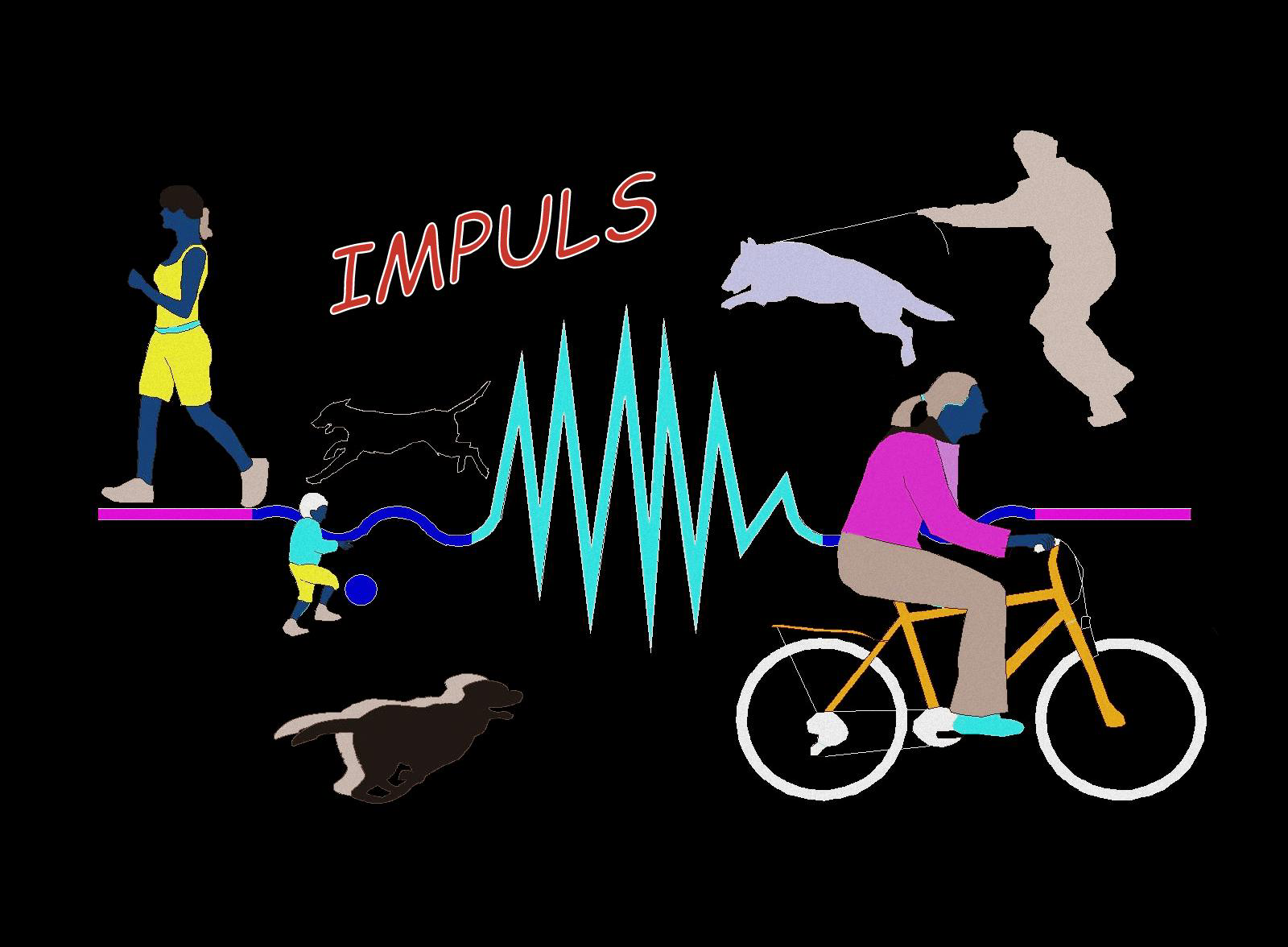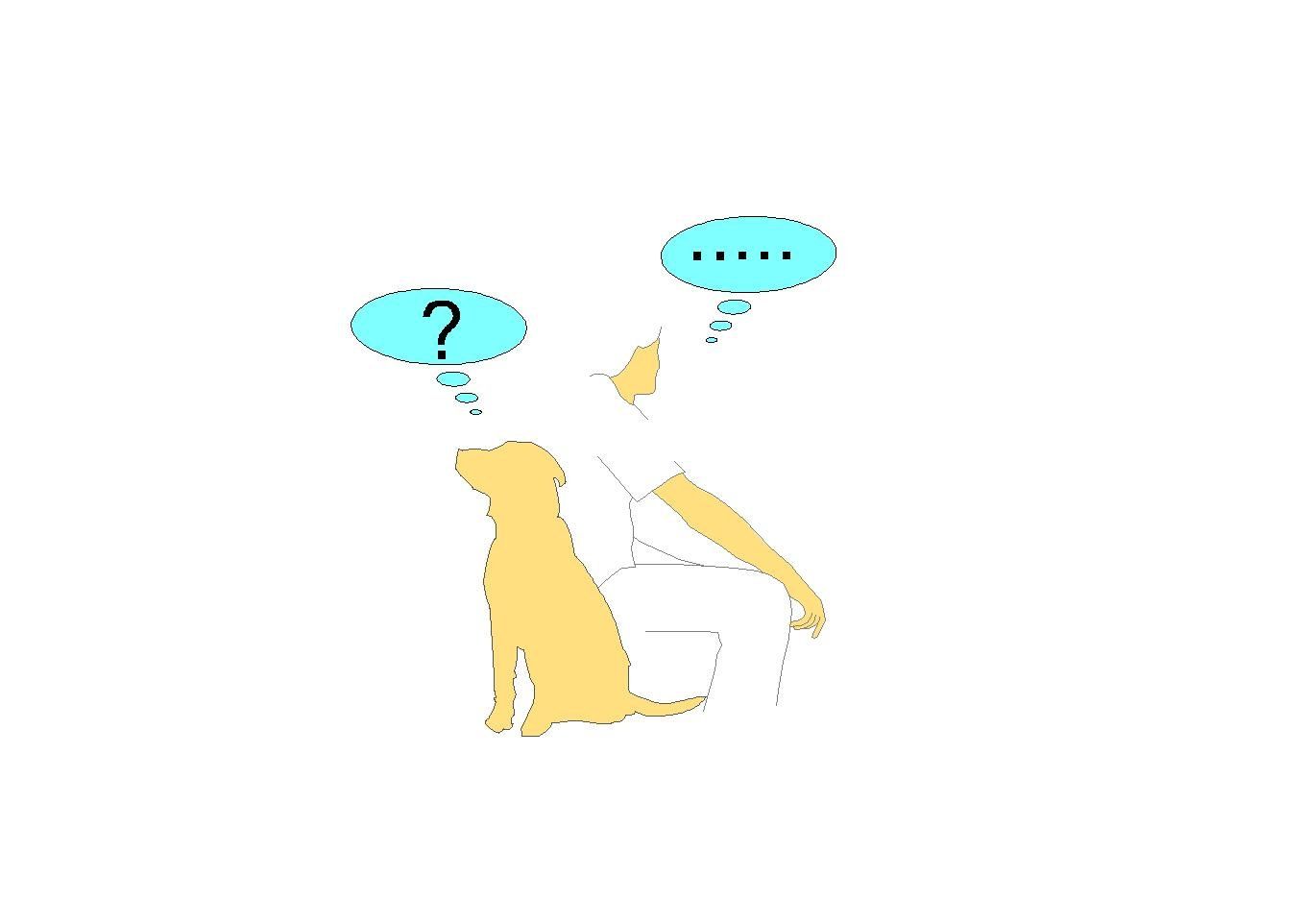Über einen Kamm scheren - Gefangen in der Tradition
Es mag sein, dass viele Menschen an ihren Traditionen kleben hängen, weil sie nicht bereit sind neue Wege zu beschreiten und vor allem Neuen zurückschrecken. Man sollte erkennen, wann alte Zöpfe abgeschnitten werden müssen. Traditionen sind gut, sollten aber kontinuierlich einer Überprüfung stand halten.
Prüfe alles und behalte das Gute
Leider ist es so, dass dieses nicht unbedingt die vorherrschende Denkweise unserer heutigen Erziehungskultur widerspiegelt. Und so versuche ich nachfolgend, einen Bogen zwischen der humanistischen Erziehung im 20. Jahrhundert und dem pädagogischem Ansatz der Hundeerziehung im 21. Jahrhundert zu spannen.
Die pädagogische Argumentation der vorherrschenden Erziehungskultur war damals geprägt von Fleiß und Disziplin. Schüler galten nur dann als gute Schüler, wenn sie sich brav und gehorsam an Regeln hielten. Auch ein guter Lehrer war nur ein guter Lehrer, wenn er als streng galt. Ein selbstverantwortliches Denken oder eigenständiges Handeln der Schüler war weder gewünscht noch wurden sie gefördert.
Selbst nach der eingeläuteten Bildungsreform im Jahre 1947 fanden immer noch Einschüchterung und verbale Entgleisungen ihren Weg in die Klassenzimmer. Auch Bestrafungen standen nach wie vor im Mittelpunkt des pädagogischen Handelns und wurden in Bayern sogar erst 1983 verboten. Es hatte sich zwar die Reform, aber nicht die Einstellung in den Köpfen von Erziehern geändert. So waren auch viele Eltern davon überzeugt, dass die Erziehung ihrer Sprösslinge in der Schule und nicht innerhalb der Familie statt finden soll. Lehrer waren mehr Demagogen als Pädagogen und versuchten ihre eigenen Ideologien an die Schüler weiter zu geben. Deren pädagogische Qualifikation kann im nach hinein ein ganzes Stück weit angezweifelt werden.
Der Ansatz im 21. Jahrhundert der humanistischen Pädagogik bestand nun darin, dass sich diese an den Bedürfnissen des Lernenden zu orientieren hat. Moderne Lehrer sollten demnach Erfahrungsmöglichkeiten und Programme zusammenstellen können, welches das Potential eines Schülers erkennt und berücksichtigt. Der Humanismus ist eine Geisteshaltung und leitet sich vom lateinischen Begriff „Menschlichkeit“ ab. Es steht für eine moralische Geisteshaltung die auf Bildung von Eigenverantwortlichkeit und Mündigkeit setzt.
Kann man diese Pädagogik auf eine Hundeschule übertragen?
Auch wenn der Vergleich vielleicht etwas weit hergeholt erscheinen möchte. Der pädagogische Ansatz dieser Geisteshaltung kollidiert dabei nicht zwingend mit dem lernen in einer Hundeschule. Ein Lernen bleibt, nur Lehrer und Schüler wechseln ihre Rolle. Auch ein Hundetrainer muss heute die Bedürfnisse seiner Schüler und deren Hunde erkennen und akzeptieren. Er muss Erfahrungsmöglichkeiten und Programme zusammenstellen können und dabei gleichzeitig die Potentiale seiner Schüler berücksichtigen. Ich lehne mich dabei nicht unbedingt großartig aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass viele Hundeplätze diesem Anspruch schon rein logistisch nicht gerecht werden können.
Gleichmacherei statt Erziehung
Kann es heute noch Hundeschulen geben, die sowohl mit ihrem Gedankengut als auch mit ihrer Erziehungskultur im 19. Jahrhundert stecken geblieben sind? Wenn darin die Bevormundung ihrer Schüler immer noch im Mittelpunkt als probates Mittel einer Erziehungsstrategie steht, muss man das leider so sehen.
Ich möchte wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn ich mir so die eine oder andere Trainingsstunde anschaue, erkenne ich darin keine Struktur, welche einen Anspruch an eine moderne Erziehung rechtfertigt. Man könnte fast vermuten, dass diese Art Hunde zu erziehen seid Jahrzehnten wie eine Tradition vom einen zum anderen weitergereicht wird. Mündige Hundebesitzer sollten solche althergebrachte Rollensysteme hinterfragen. Wenn überhaupt einer den Takt bestimmen kann, ist das weder die Hundeschule noch der Trainer sondern der Besitzer und dessen Hund.Viele erlernte Handlungsweisen von Hunden scheinen weit von dem entfernt zu sein, was ich unter Erziehung verstehe.
Bedürfnisse erkennen
Die Erwartungshaltung an Hunde und der Anspruch von der Gesellschaft haben sich dramatisch geändert. Nur die Geisteshaltungen diverser Erziehungsmethoden sind im letzten Jahrhundert stecken geblieben. Grundsätzlich wird sich daran auch nicht viel ändern, solange sich der Anspruch an eine adäquate Erziehung nicht verändert.
Hundeschulen müssen heute flexibel sein, dabei Mensch und Hund als Individualisten ansehen, deren Probleme erkennen um Lösungen anbieten zu können. Hundetrainer sollten sich in die Sichtweisen ihrer Kunden hineinversetzen und sie emotional mitnehmen können. Sie müssen Gefühle und Bedürfnisse bei Mensch und Tier erkennen, akzeptieren und sich deren Problem annehmen. Sie müssen über fundierte Grundlagen in der Kynologie (Erziehung, Verhalten, Psychologie, Rassekunde, Krankheiten, Anatomie etc.) verfügen. Sind gleichzeitig aber auch Sozialtherapeuten und Konfliktmanager.
Mit viel Akribie beschäftigen sich heutige moderne Eltern, wenn sie eine geeignete Kita, oder eine Schule für ihren Sprössling suchen. Alles wird hinterfragt. Wie sieht das pädagogische Konzept aus? Was für Frühforderungsmaßnahmen gibt es? Ist das Personal geschult und zeigen diese ehrliches Interesse? Sind die Erzieher flexibel genug und können auch vom normalen Modus abweichen?
Warum, so frage ich mich, warum um Himmelswillen hinterfragen die selber Eltern, die Konzepte von Hundeschulen nicht mit der selben Akribie, wenn es um die Erziehung ihrer Hunde geht? Vielleicht liegt es einfach nur daran „weil man das immer schon so gemacht hat“. Eine „Killerphrase um von der eigenen Unwissenheit abzulenken.
Fokussieren auf das falsche Ziel
Die Erwartungshaltung an eine Hundeschule muss darin bestehen, Hundebesitzern bei der Verwirklichung ihrer erzieherischen Ziele zu begleiten und Wissen fördern. Wenn sich dabei aber der eigentliche Focus verschoben hat, gehen Erwartung, Ziel und Erfolg getrennte Wege. Dabei vergisst man allzu oft, dass man nicht nur Hundebesitzer sondern auch Kunde ist. Als solcher hat man einen Anspruch, dass eine Schule den nötigen Rahmen dazu bereit stellen kann.
Heute sind so gut wie alle vereinsgeführten Hundeschulen in irgendwelchen Verbänden organisiert. Die meisten davon setzten ihre Prioritäten auf den Hundesport und an das Ziel bestimmte Leistungskriterien zu erreichen. Nicht jeder Hund der sich ganz oben auf dem Podest wiederfindet, ist nicht gleichzeitig auch gut erzogen. Dabei wird das eigentliche Ziel der Erziehung durch Prüfungen, Normen und Vorgaben an ein Endergebnis in den Hintergrund gedrängt. Eine Erziehung benötigt weder eine Norm noch eine Prüfungsordnung und definiert sich im Gegensatz zum Lernen nicht über ein Endziel.
ERZIEHUNG (Emotionale Intelligenz)
- ist ein Prozess der im frühesten Alter beginnt und nie endet
- sollte eine positive psychische Stabilität des Wesens bewirken
- ist ein Entwicklungsprozess und läuft nie linear ab
- dient zur sozialen Regelung innerhalb und außerhalb einer Gruppe
- dient dazu die Persönlichkeit eines Hundes zu erkennen und zu fördern
- stellt die emotionale Handlung und nicht dessen Arbeitsleistung in den Vordergrund
LERNEN (Kognitive Intelligenz)
- ist ein Prozess, der am Ende zu einem Abschluss führt
- kümmert sich nicht um psychische Störungen
- funktioniert nur linear
- dient zur Regelung bestimmter Vorgaben und von Mustern
- dient dazu eine Fähigkeit oder eine Geschicklichkeit zu erwerben
- ist nicht automatisch mit einem Verständnis verbunden
- heißt nicht automatisch alles zu verstehen
- setzt nicht voraus, dass man das erworbene Wissen auch benötigt
- führt nicht zum Erfolg, wenn das Ziel nur den Lernvorgaben dient
- heißt nicht die Zusammenhänge von zufälligen Ereignissen zu unterscheiden
Fazit
Falls sie, lieber Leser, jetzt vermuten, dass ich das Lernen zu Gunsten einer Erziehung negiere, so wäre das ein fataler Irrtum. Beides ist wichtig. Solange aber eine Erziehung vom formalen Exerzieren gebeugt wird, habe ich damit ein großes Problem.
Jede Erziehung ist natürlich auch mit einem Lernen verbunden!
Aber nicht jedes Lernen dient als Erziehung!
„Man handelt immer in der Zeit, in welcher man selber stecken geblieben ist“
Bleiben sie mir gewogen.
Manfred Gibisch